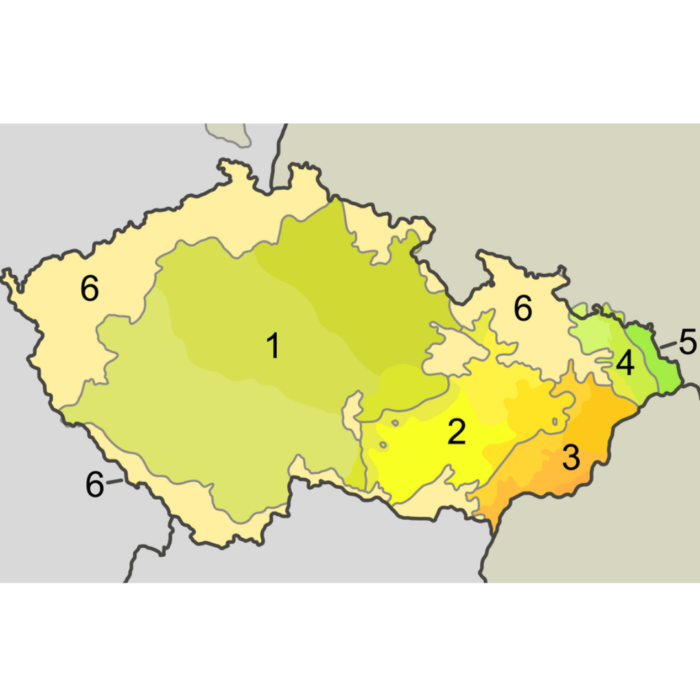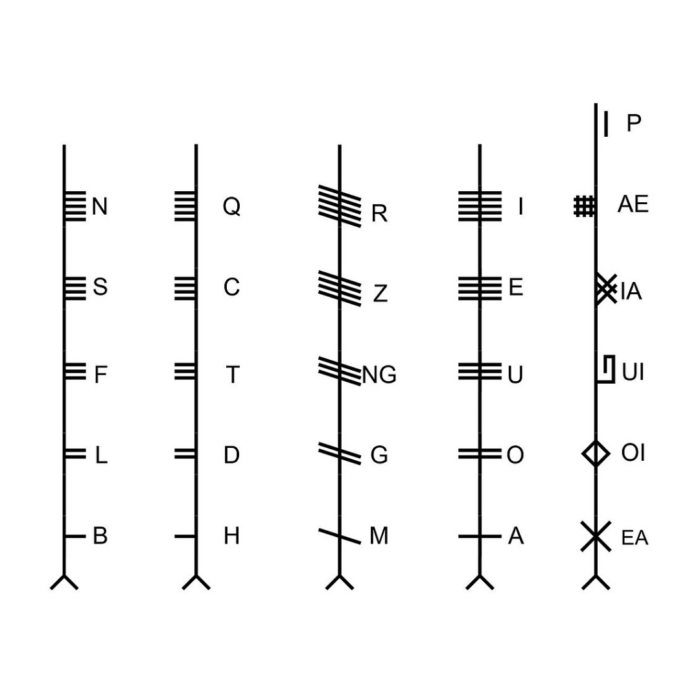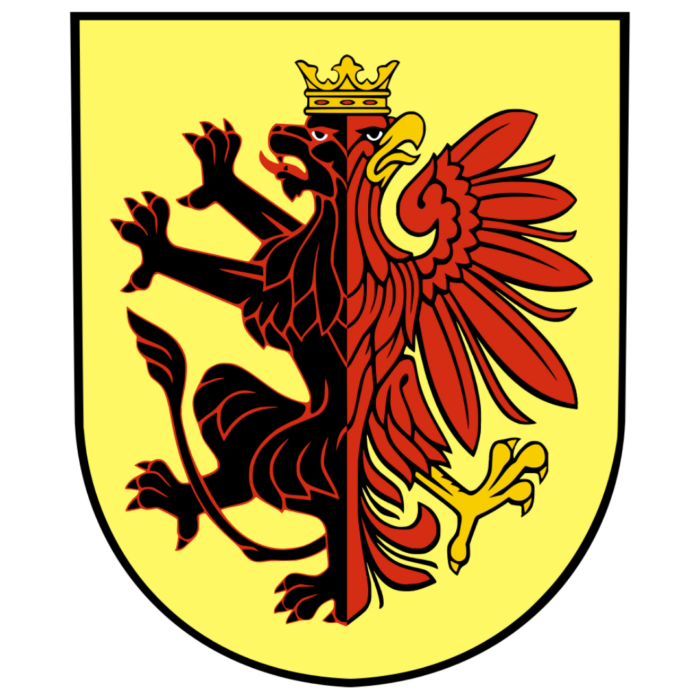Die Völker im Norden Europas lebten oft in Gruppen, die über weite Distanzen und unwegsames Gelände voneinander getrennt waren. Die Finnen als Stamm wanderten wahrscheinlich vor fünftausend Jahren aus der Richtung des Urals ins Gebiet des heutigen Finnlands und Umgebung ein.
Die Verbindung mit anderen finno-ugrischen Völkern sieht man nicht nur in der Verwandtschaft der Sprachen, sondern auch in Ähnlichkeiten der Mythologie. Die geografische Nähe zu den Nordgermanen und Samen hat ebenfalls zu Überschneidungen der finnischen, samischen und nordischen Legendenwelt beigetragen.
Heutzutage hat die finnische Mythologie wieder viele Anhänger, die eine moderne Art des Heidentums leben, oft gemischt mit anderen Kulturformen.
Der erste, der Teile der finnischen Mythologie gesammelt hat, war Reformator Mikael Agricola (1510–1555). Er ließ Kommentare zur finnischen Folklore in seine Psalmenübersetzung von 1551 einfließen. Der Großteil der Mythen ist im finnischen Nationalepos, dem Kalevala, gesammelt. Das Kalevala ist erst 1835 erschienen und besteht aus über zweiundzwanzigtausend Versen. Vorher wurde die Mythen mündlich weitergegeben und im 19. Jahrhundert von Elias Lönnrot aufgeschrieben worden. Außerdem stellt das Kalevala eins der wichtigsten literarischen Werke der finnischen Sprache dar. Wegen der späten Verschriftlichung der Mythen lässt sich nur schwer sagen, wann welche Einflüsse fremder Elemente Eingang in die Mythenwelt der Finnen gefunden haben.
Wie jede Mythologie ist die Entstehung der Welt auch bei den Finnen ein zentrales Motiv. Sie glaubten, dass die Welt aus Vogeleiern entstanden ist. Eine Geschichte spricht von einem Adlerweibchen, das über das Wasser fliegt und nach einem Platz für sein Nest sucht. Sie findet eine trockene Stelle, die zufällig das Knie des schlafenden Zauberer Väinämöinen ist, und legt ihr Ei ab. Der Zauberer erwacht und erhebt sich, das Ei zerbricht und heraus kommen der Mond und die Sonne, während aus den Schalen die Erde und die Sterne werden. Andere Geschichte erzählen von Eiern anderer Vögel wie einer Ente oder einer Schwalbe, aus denen die Welt erschaffen wurde.
Tiere sind in der finnischen Mythologie allgegenwärtig. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Finnen vielerorts von der Jagd abhängig waren und daher Tiere als heilige Tiere ansahen. Das heiligste von ihnen ist der Bär, aber auch alle möglichen (Wasser-)Vögel.
Nicht nur in der Schöpfungsgeschichte der Finnen spielen Vögel eine zentrale Rolle. Sie tauchen immer wieder auf. Vögel verleihen den Menschen ihre Seele im Augenblick der Geburt und nehmen sie im Tod. Für die Finnen ist der Tod eine unausweichliche Sache. Alle Toten treten, unabhängig von ihren Taten im Leben, die Reise ins Totenreich an, zum Fluss Tuonela. Dort herrschen die Götter der Unterwelt Tuoni und Tuonetar, zusammen mit der Göttin des Todes und der Verwesung Kalma.
Wie in der Mythologie der Sibirer können Schamanen das Totenreich betreten und wieder verlassen. Diese Gabe haben normale Menschen nicht, sie kehren nie zurück.
Die Götter der Finnen sind zahlreich und wie in anderen Mythologien mit verschiedenen Attributen und Aufgaben versehen. Der höchste Gott ist Ukko, der Gott des Himmels und des Gewitters, der in dem Kalevala als alter weißbärtiger Mann beschrieben wird. Eine zufällige Ähnlichkeit mit Odin und Thor aus der nordischen Mythologie? Die höchste Göttin der Finnen ist Akka ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Neben vielen anderen Göttern gibt es Geister, Dämonen und Tiergeister.
Oft variieren die Namen der Götter und der Inhalt der Legenden je nach Region und überschneiden sich mit anderen Mythologien z.B. den Esten oder Germanen. Wer von wem etwas übernommen hat, lässt sich kaum noch nachvollziehen, zeigt aber, dass die Volkgruppen nicht so isoliert voneinander gelebt haben wie manchmal angenommen wird. Vor allem der Handel zwischen den Völkern im Norden Europas und im Ostseeraum sorgte für die Mischung, die in den Geschichten aufgeschrieben wurden.
Quellen
Grimal, Pierre. Mythen der Völker III. Fischer Bücherei. Hamburg 1963
Honko, Lauri. Finnische Mythologie. In: Hans Wilhelm Haussig (Hrsg.): Götter und Mythen im Alten Europa (= Wörterbuch der Mythologie. Abteilung 1: Die alten Kulturvölker. Band 2). Klett-Cotta, Stuttgart 1973