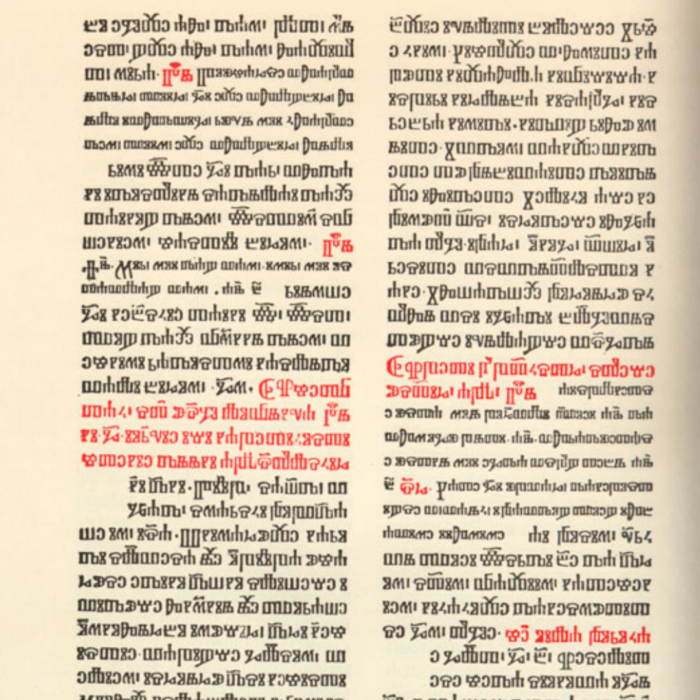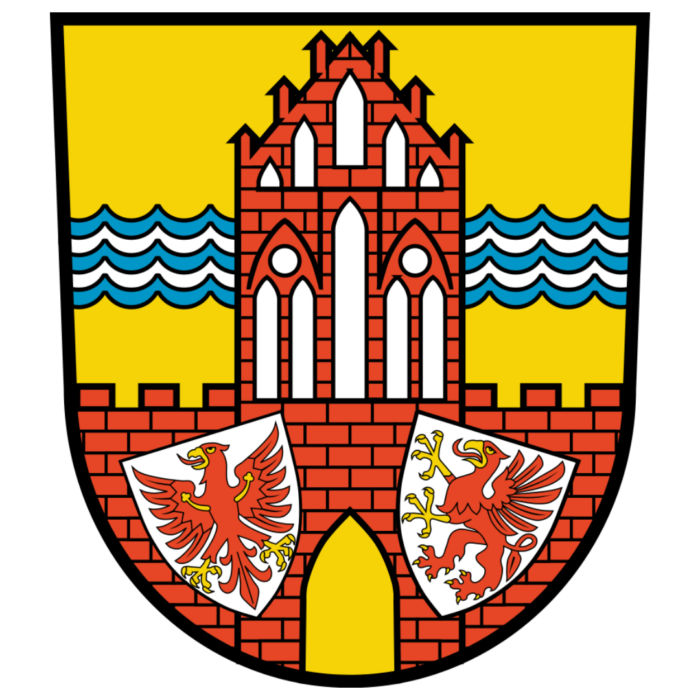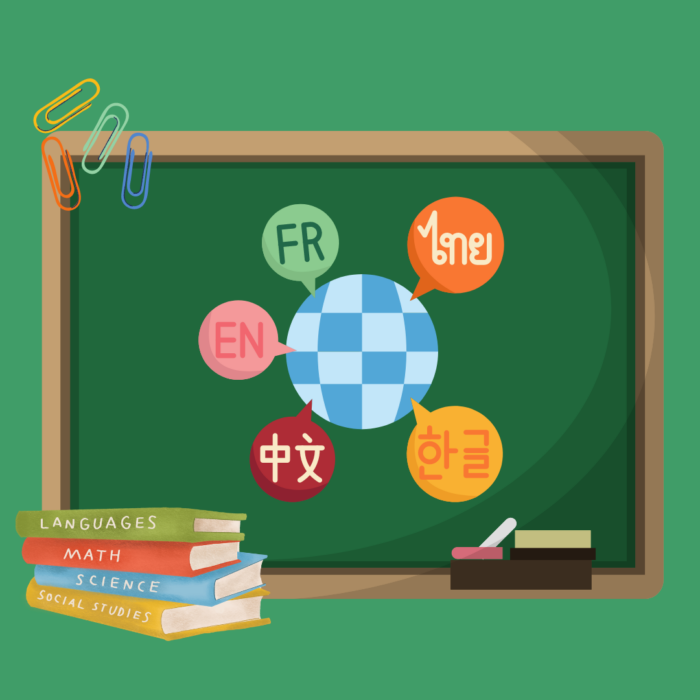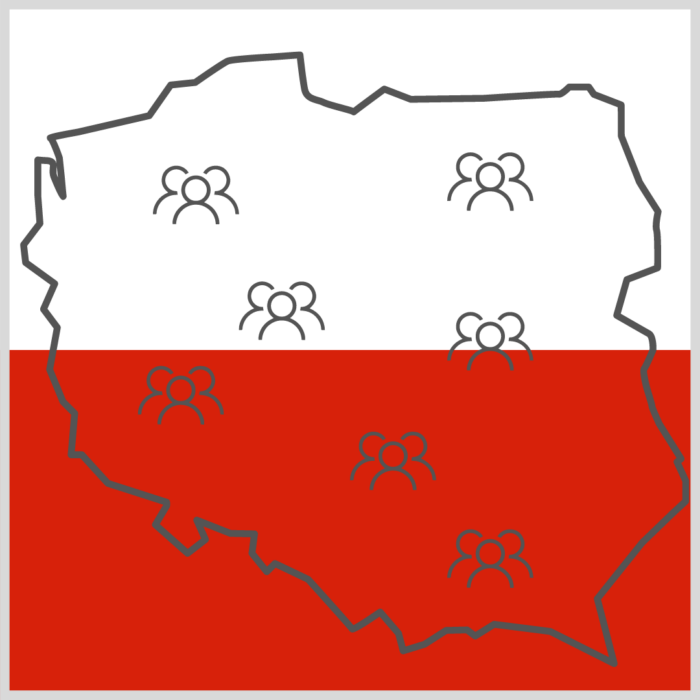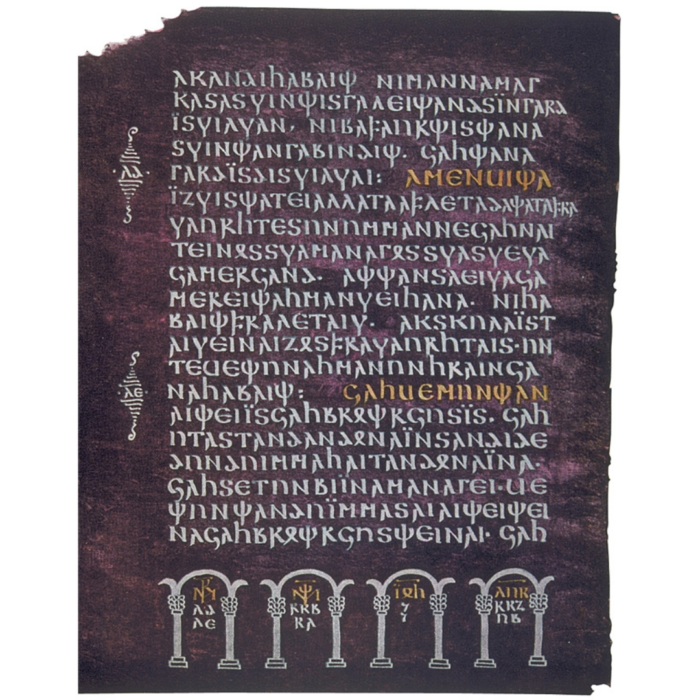Die polnische Literatur hat viele bedeutende Künstler*innen vorzuweisen, vorwiegend Männer. Doch auch einige Frauen haben sich in dieser Domäne einen Namen gemacht und veränderten mit ihren Werken das Land. Eine von ihnen ist Zofia Kossak, die nicht nur Schriftstellerinn, sondern auch Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg war.
Zofia Kossak wurde am 10. August 1889 in Kośmin, einem Ort in der Nähe von Lublin, in eine Künstlerfamilie hineingeboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der Region Lublin. Ab 1906 arbeitete sie als Lehrerin in Warschau. Sie besuchte dort von 1912–1913 die Kunstakademie im Fach ‚Malerei‘ und wechselte nach Genf, wo sie ihr Studium aufgrund des Krieges unterbrechen musste.
1915 heiratete Zofia Kossak und lebte mit ihrem Mann in Nowosielica in der heutigen Ukraine. Sie bekam zwei Söhne und erlebte dort nicht nur das Kriegsende, sondern auch den Ausbruch des Polnisch-Sowjetischen Krieges. Die Familie zog 1919 nach Lwiw, Kossak arbeitete dort für eine polnische Zeitung und schrieb an ihrem ersten großen Werk ‚Pożoga‘ (dt. Feuersbrunst), in dem sie die Erlebnisse aus dem Polnisch-Sowjetischen Krieg verarbeitete.
Kossaks Mann starb 1921 und sie zog mit den Kindern zu ihrem Vater ins Teschener Schlesien. Sie heiratete 1925 erneut und bekam noch zwei Kinder. In dieser Zeit starb ihr erstgeborener Sohn Juliusz. Sie schrieb in der Zeit viel, erhielt Auszeichnungen wie den Literaturpreis der Woiwodschaft Schlesien und engagierte sich in bei den Pfandfindern, u.a. gründete sie ein Zentrum für die Pfadfindervereinigung. Seit Mitte der 1930er Jahre lebte Kossak mit ihrem Mann, ohne die Kinder, in Warschau und schrieb in der Zeit mehrere historische Romane u.a. ‚Krzyżowcy‘ (dt. Die Kreuzfahrer) und ‚Król trędowaty‘ (dt. Der Leprakönig).
Der Überfall der Deutschen auf Polen zwang sie zur Flucht, jedoch kehrte sie schon Ende September mit ihren Kindern nach Warschau zurück und arbeitete journalistisch im polnischen Untergrund. Sie war in verschiedenen Untergrund-Hilfsorganisationen tätig, u.a. der Żegota, die vor allem Juden half gefälschte Dokumente zu erhalten oder sie aus den Ghettos zu schmuggeln. Auch für Organisationen der katholischen Kirche war Kossak tätig, neben ihrer schriftstellerischen und publizistischen Arbeit.
Die Arbeit im Untergrund drohte immer wieder aufzufliegen, die Deutschen schleusten oftmals Informanten ein. Im September 1943 wurde Kossak bei einer Straßenkontrolle verhaftet und nach Ausschwitz deportiert. Das Angebot für die Deutschen zu arbeiten, lehnte sie ab und sollte hingerichtet werden. Doch einflussreiche Freunde konnten ihre Freilassung bewirken. Wieder zurück in Warschau beteiligte sie sich zusammen mit ihrer Tochter Anna am Warschauer Aufstand im August 1944.
Nach dem Kriegsende verließ sie, nicht ganz freiwillig, Polen und ging nach London. Erst nach zwölf Jahren kehrte sie in ihre Heimat zurück und schrieb für verschiedene Zeitungen. Zofia Kossak starb am 9. April 1968 und fand ihre letzte Ruhe in Górki Wielkie im Teschener Land.
Sie hinterließ ein umfangreiches Werk, einiges wurde schon zu ihren Lebzeiten ins Deutsche, Französische und Englische übersetzt. Kossak schrieb Romane, Kurzgeschichten, Essays u.v.m., nicht zu vergessen die Schriften für die Untergrundzeitungen. Ihre Schriften zeigen ihre eher konservativ-katholische Haltung, die ihr mit unter als Antisemitismus ausgelegt wurde. Ihr Verhältnis zu anderen Literaturschaffenden in Polen war oft angespannt. Sie äußerte sich auch immer wieder kritisch zu politischen Themen und stand dem Kommunismus ablehnend gegenüber.
Ihre Arbeit im polnischen Untergrund sah sie als Pflicht einer Christin an, deren Aktivismus sich vor allem gegen die Deutschen richtete. Es ist nicht ganz geklärt wie viele Juden durch ihre Arbeit in den Untergrundorganisationen gerettet wurden, Schätzungen gehen von einigen Tausend aus. Sie erhielt dafür Auszeichnungen, auch noch posthum z.B. den Titel ‚Gerechte unter den Völkern‘ der Gedenkstätte Yad Vashem.
Das Andenken an ihr literarisches Schaffen wird deutlich, wenn man sich die Pflichtlektüre in polnischen Schulen anschaut, wo sie mit einigen Werken präsent ist. Die Reflektion der Lektüre ist ebenso notwendig wie spannend, genauso wie das Leben von Zofia Kossak.
Quelle
Jurgała-Jureczka J. Zofia Kossak. Opowieść biograficzna, Warszawa. PWN, 2014
Pałaszewska M. Zofia Kossak, Warszawa. Borowiecky, 1999