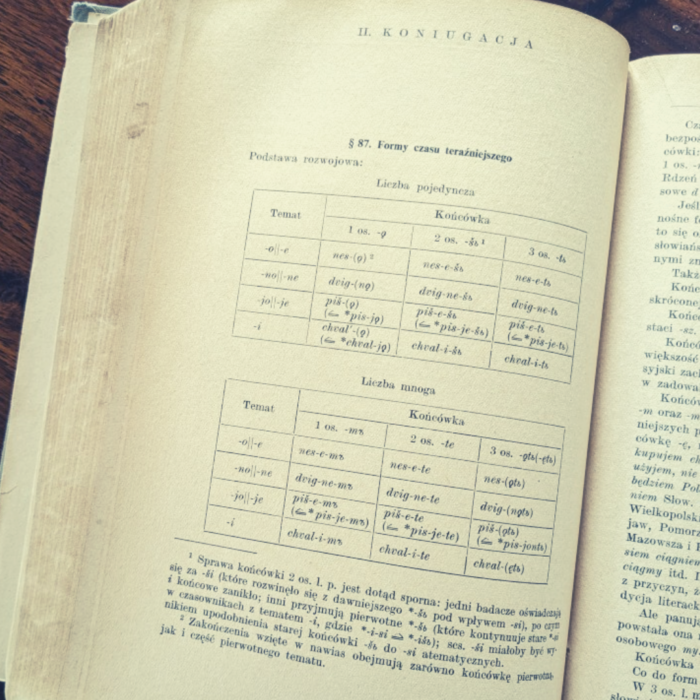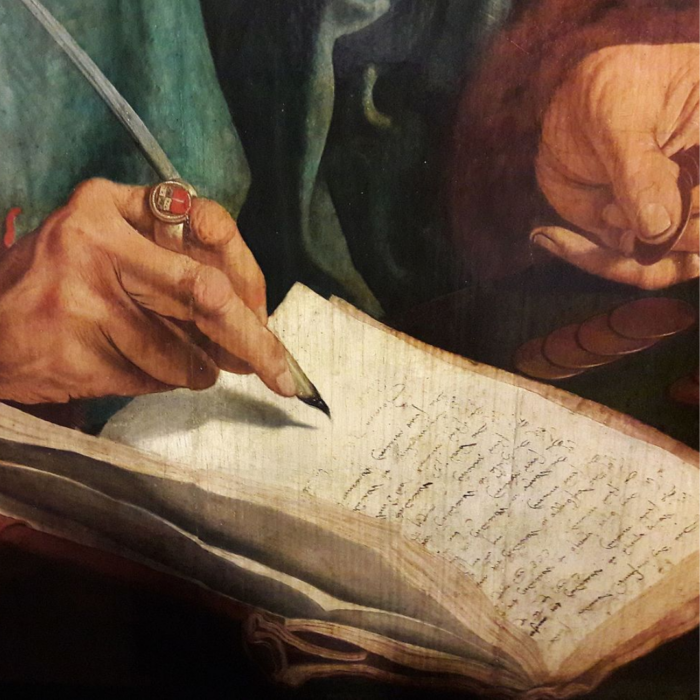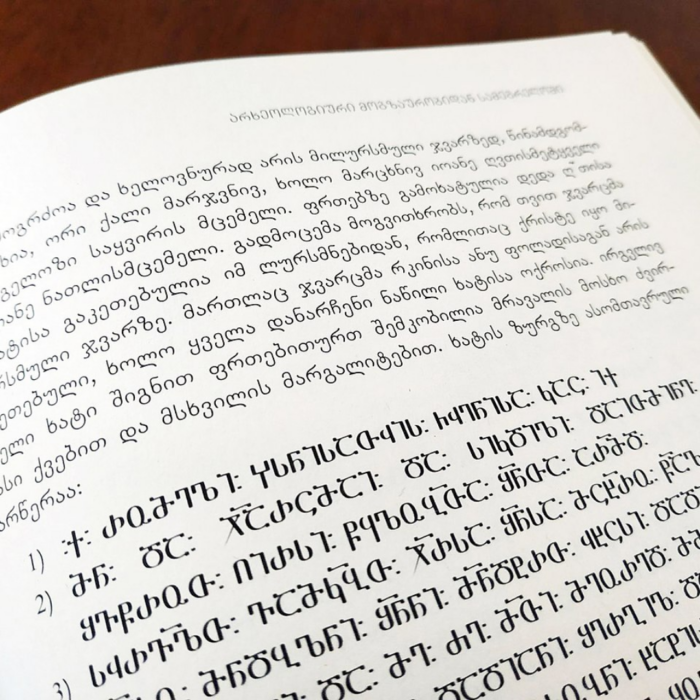Die historische Region Mecklenburg ist heute Bestandteil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland. Der Name ‚Mecklenburg‘ bezieht sich auf die Burg Mecklenburg, altsächsisch ‚Mikilinborg‘, die als Hauptsitz der Abodriten genutzt wurde. Erste Erwähnung findet sich in einer Urkunde des späten 10. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Name über das Niederdeutsche zu ‚Mecklenburg‘.
Bis zur Völkerwanderung ca. 4. Jahrhundert n.Chr. siedelten dort germanische Stämme, die dann weiter Richtung Süden zogen. Um das 6. Jahrhundert zogen slawische Stämme in das Gebiet rund um das heutige Schwerin und Wismar. Die Ostsee bildet eine natürliche Grenze im Norden, während von Osten und Süden andere slawische Stämme und im Westen Franken und Sachsen lebten. Die Region wurde von den elbslawischen Stämmen der Abodriten beherrscht, rund um das heutige Wismar und Schwerin. Die Region eignete sich über die Wasserwege wie die Ostsee und die Flüsse gut für den Handel als Lebensgrundlage.
Ab dem 12. Jahrhundert gerieten die slawischen Herrscher immer mehr in Bedrängnis durch ihre Nachbarn. Wie viele Völker waren sie in kleine Herrschaftsgebiete geteilt und konnten den Sachsen oder Franken keine große Streitmacht als Verteidigung entgegensetzten. Mecklenburg wurde Teil des Heiligen Römischen Reiches. Auch die Dänen zeigten zum Ende des 12. Jahrhundert großes Interesse an der Eroberung Mecklenburgs, um ihren Einflussbereich auszuweiten.
Nach und nach vermischten sich die Slawen mit Siedlern, die vor allem aus dem Westen und Norden in die Region zogen. Sie brachten nicht nur das Christentum, sondern auch landschaftliche Innovationen, mit. Damit stiegen die Erträge und die Bevölkerungszahl stieg an. Mit den Siedlern entstanden immer mehr Siedlungen, die sich in kurzer Zeit zu Städten entwickelten. Die Nähe zur Hansestadt Lübeck, gegründet von slawischen Polaben, hatte ab dem 13. Jahrhundert Einfluss auf die Region Mecklenburg, was mit einem Handelsbündnis Lübecks mit Rostock und Wismar besiegelt wurde.
Die strategisch wichtige Lage machte Mecklenburg zum Opfer mehrerer Teilungen u.a. 1229, 1621 und 1701, infolge von Kriegen oder Teilungen durch Erbansprüche verschiedener Herrschaftslinien, trotzdem bestand zwischen den Fürstentümern immer eine Verbindung in Form von politischer und wirtschaftlicher Verbundenheit. Teile des Gebietes fielen im 18. Jahrhundert an Hannover und Preußen, bis Napoleon einfiel und es über Jahre besetzte. Der Wiener Kongress 1815 stellt die Souveränität der Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz wieder her und dies blieb bis 1918 bestehen.
Ab 1918 entstanden aus den beiden Gebieten zwei Freistaaten, die sich unter dem Druck der Nationalsozialisten 1934 zum Land Mecklenburg vereinigten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der größte Teil der Region sowjetisch-besetztes Gebiet und wurde zu DDR-Zeiten in Bezirke geteilt, wie das gesamte Gebiet der DDR. Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten schuf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern wie wir es heute kennen (bis auf einen kleinen Zipfel im Südwesten, der jetzt zu Niedersachsen gehört.)
Das Wappen des Herzogtums Mecklenburg zeigt einen Stierkopf auf goldenem Grund, mit silbernen Hörnern und einer goldenen Krone. Es trat in dieser Form ab 1219 auf.
Quellen
Heitz, Gerhard &Rischer, Henning. Geschichte in Daten. Mecklenburg-Vorpommern. Koehler & Amelang, München und Berlin 1995
Karge, Wolf &Münch, Ernst &Schmied, Hartmut. Die Geschichte Mecklenburgs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hinstorff, Rostock 2011
Bildquelle
Autorstwa Ipankonin – Ten plik jest pochodną pracą: Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3201708