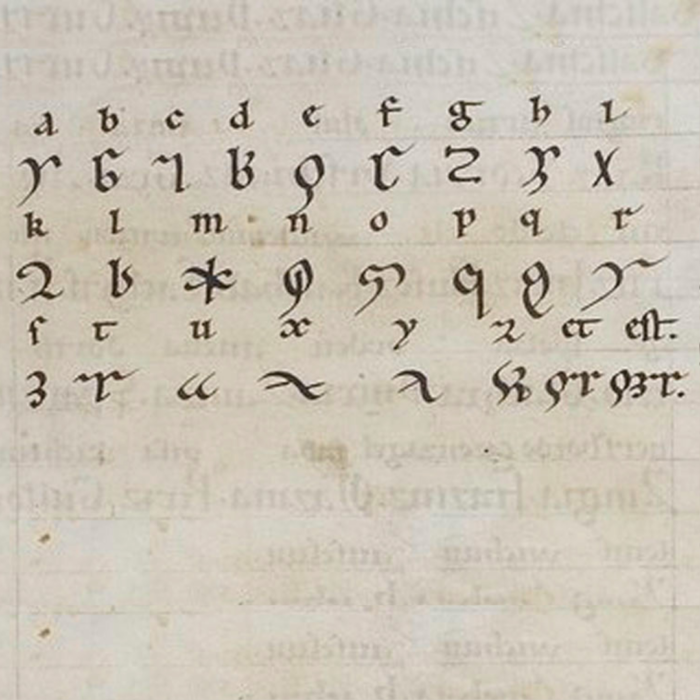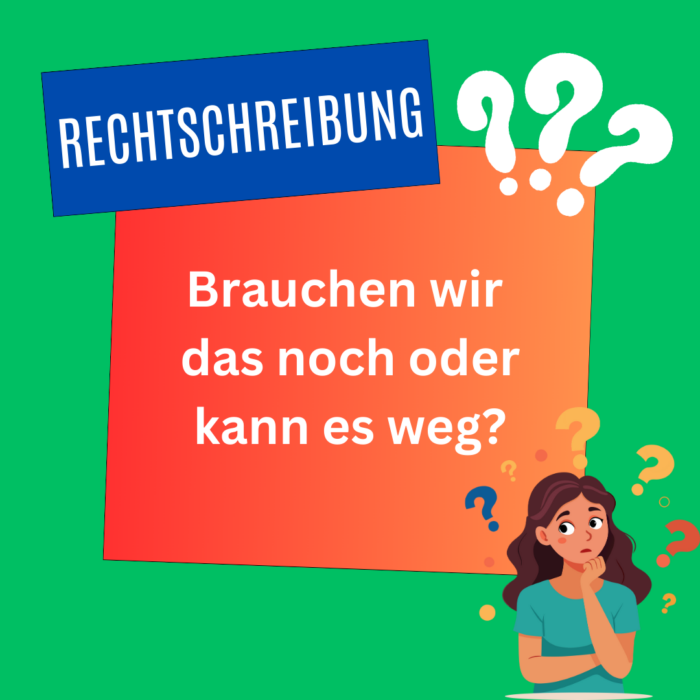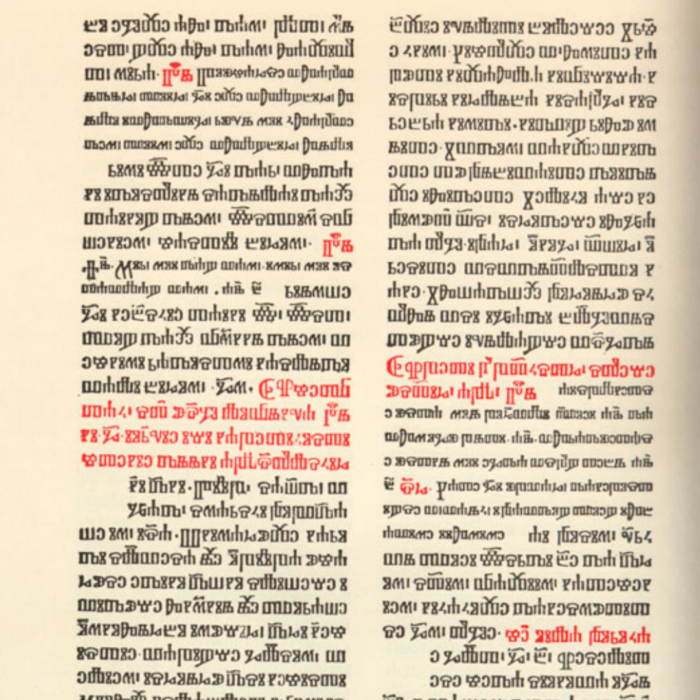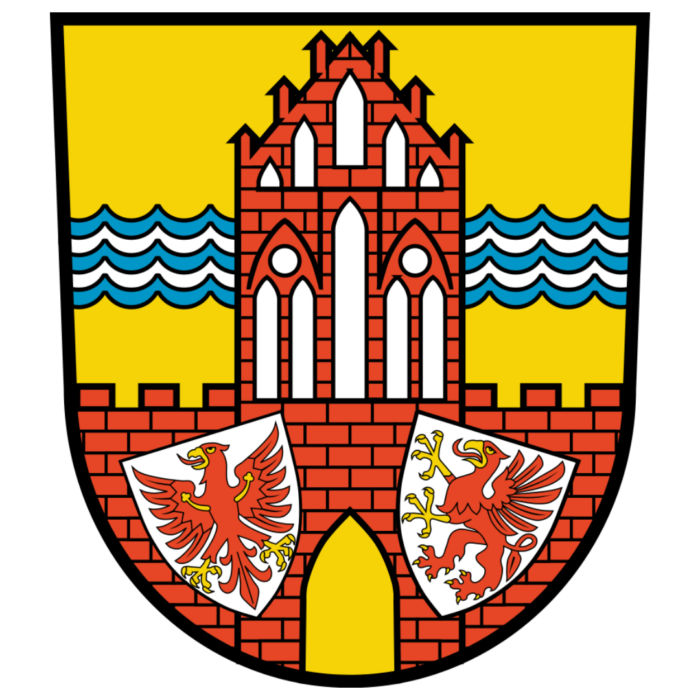Im Gegensatz zu Deutschland ist Österreich klein, jedoch existieren dort genauso viele verschiedene Sprachgemeinschaften. Deutsch ist laut der österreichischen Verfassung die Staatssprache, wobei es sich vom Standarddeutsch in Deutschland stark unterscheidet. Es ist die Erstsprache von knapp 90% der österreichischen Bevölkerung, was prozentual weniger Menschen als in Deutschland sind. Doch welche Sprachen sprechen die gut 10% ohne Deutsch als Erstsprache?
Neben der Amtssprache Deutsch finden sich in Österreich die verschiedensten Sprachen, von denen einige als Minderheitensprachen anerkannt sind. Laut Gesetz sind es sieben Sprachen: Burgenlandkroatisch, Romani, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch, Ungarisch als Sprachen autochthoner Minderheiten und Österreichische Gebärdensprache als eine Sprache einer nicht-ethnischen Sprachgemeinschaft. Das Volksgruppengesetz von 1976 und die Verfassung regelt alle Rechte der anerkannten Minderheiten. Österreich hat, wie viele Länder der EU, 2001 die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen ratifiziert und sich damit dem Schutz seiner Minderheiten verpflichtet.
Die Burgenlandkroaten leben v.a. im Burgenland an der Grenze zu Ungarn und machen in dieser Region etwa 6% der Bevölkerung aus. Sie sprechen eine Variante des Kroatischen, mehrheitlich herausgebildet aus dem čakavischen Dialekt. Zum heutigen Standardkroatischen gibt es viele Unterschiede z.B. in der Aussprache und der Einflüsse des Deutschen und Ungarischen. Auch eine ungarisch-sprechende Minderheit lebt im Burgenland. Als dritte Sprache ist das Romani hier besonders geschützt, Sprecherzahlen variieren und ihre Sprecher*innen sind nicht nur auf das Burgenland beschränkt. Doch anders als in Deutschland ist Romani nur regional anerkannt.
Die slowenische Minderheit findet man in Kärnten und der Steiermark, ihre genaue Zahl lässt sich aber nur schwer ermitteln. Sie standen in den letzten Jahrzehnten unter starkem Assimilationsdruck. Aktuelle Volkszählungen gehen von 15-20 Tausend Angehörigen dieser Minderheit aus und nicht alle sprechen Slowenisch. Immer wieder beklagen Vertreter dieser Minderheiten die mangelnde Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Minderheitenschutzes. Die zwei Minderheitensprachen Slowakisch und Tschechisch haben ihren Schutzstatus nur in Wien.
Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist eine verwandte Gebärdensprache der Deutschschweizer Gebärdensprachen, hat also kaum Verbindung mit der Deutschen Gebärdensprache. In Österreich sprechen etwa 12 Tausend Menschen diese Sprache. Offiziell ist sie seit 2005 anerkannt, doch fehlen bis heute weiter Gesetze, die z.B. den Bereich Schulbildung behandeln.
In Österreich werden aber auch zahlreiche andere Sprachen gesprochen. Diese haben allerdings nicht den Status der Minderheitensprachen und werden deshalb weder in den Schulen angeboten noch genießen sie andere Rechte. Häufig gesprochene Sprachen sind z.B. Serbisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch und Albanisch.
Die Sprachenpolitik Österreichs ist in dieser Hinsicht sehr konservativ, ähnlich wie in Deutschland. In Gemeinden mit autochthonen Minderheiten ist das Land eigentlich verpflichtet zweisprachige Beschilderung im Stadtbild zu gewährleisten, was bisher nur wenig umgesetzt wird. Die Gemeinden sind auch verpflichtet muttersprachlichen Unterricht anzubieten, was nicht überall möglich ist. Das betrifft natürlich auch alle anderen Sprachen ohne Minderheitenstatus. Die Suche nach Lehrkräften und die Kapazitäten in den Schulen stellen dabei ein großes Problem dar.
Quellen
Statistika Austria https://www.statistik.at/